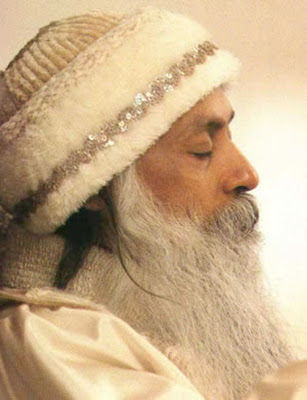Kann man voraussagen, ob die Liebe dem Alltag standhält? Nicht unbedingt. Aber es gibt laut Studien Eigenschaften, die Langzeitpaare teilen. Testen Sie Ihr Liebesverfallsdatum.
Die Liebe – sie ist vielleicht das am meisten studierte und am wenigsten verstandene Objekt der psychologischen Forschung. Gerade weil sie sich dem Labor und der Statistik komplett entzieht. Nun hat Daniel O'Leary mit seinem Team versucht, die Liebe unter Liebenden zu studieren. Genauer gesagt: Er hat Paare, die seit über zehn Jahren verheiratet oder zusammen sind und sich als glücklich bezeichnen, auf Herz und Nieren überprüft. Und siehe da: Langzeitehen können alles andere als kühl und leidenschaftslos sein. Immerhin gaben 40 Prozent der Befragten an, dass sie noch immer in ihre Partner verliebt seien und sich das auch im Bett recht häufig zeigten.
Daraufhin haben die Forscher versucht herauszufinden, was denn Paare gemeinsam haben, die bereits seit 30 Jahren zusammen sind und angaben, sehr glücklich zu sein. Wer nun erwartet, dass eine lange Liste kommt, die von Nähe, Kommunikation und Leidenschaft zeugt, hat nicht unrecht. Doch die Prise Pragmatismus ist nicht zu unterschätzen.
Testen Sie also ihre Beziehung:
1. Positiv über den Partner denken. Langzeitpaare streiten sich auch – aber sie zählen, fragt man sie, mehr positive als negative Eigenschaften über den Partner auf. Sie haben gelernt, ihren Partner zu ertragen, und das Gedächtnis darauf konditioniert, schlechte Erinnerungen zu verstecken, gute hingegen jederzeit abrufbar zu speichern.
2. In der Ferne die Nähe suchen. Nach 30 Jahren Ehe will man nicht mehr dauernd aufeinander hocken. Doch offenbar denken Langzeitpaare regelmässig an den Partner, wenn sie von ihm getrennt sind. (Lesen Sie auch: «Lust auf Distanz»)
3. Kein Multitasking beim Paarprobleme wälzen. Wer einen Streit mit dem Partner einfach schnell wegstecken und zur Tagesordnung übergehen kann, zeigt nicht das Verhalten, das Langzeitpaare zu Protokoll gegeben haben. Multitasking hört bei ihnen spätestens dann auf, wenn sie intensiv an den Geliebten denken.
4. Gemeinsame und neue Hobbys. Klar doch, Paare, die sich mögen, verbringen viel Zeit miteinander. Doch offenbar profitiert die Langzeitliebe vorab, wenn ein Paar gemeinsam eine neue Leidenschaft entdeckt. Vorzugsweise eine, die komplizierter ist als Kaffeerahmdeckeli sammeln.
5. Zeit gemeinsam verbringen. Zeit lässt die Liebe wachsen. Zumindest dann, wenn sie oft gemeinsam verbracht wird. Und dabei zählt nicht nur die Freizeit, sondern auch die Pflicht. Langzeitpaare verbringen nachweisbar mehr Zeit beim gemeinsamen Haushalten, Kochen, Putzen, Gärtnern als Lebensabschnittspaare.
6. Die Liebe benennen. Fühlen ist gut und recht. Kommunizieren ist besser. Typische Ausdauerliebende sagen sich regelmässig, dass sie sich lieben. Mit Worten und mit Gesten. Das muss nicht immer der elaborierte Liebesbrief oder ein Kamasutra-Ausdauertraining sein. Ein Kuss, eine kleine Notiz auf dem Tisch genügen. (Lesen Sie auch: «Was Frauen an Männern lieben»)
7. Begehren zeigen und leben. Ja – ohne wirds schwierig. Zumindest wer Jahrzehnte aushalten will, sollte seinen Partner begehren, sich von ihm körperlich angezogen fühlen und das auch zeigen. Wer beim Küssen ans Abendessenkochen denkt, sollte mal in sich gehen.
8. Sex haben, regelmässig. Die Anziehung ist nicht immer gleich gross. Und selbst wer eben beim Küssen auch mal an den Brokkoli im Kühlschrank denkt, ist kein Single-Kandidat. Sex kann man auch mal haben, wenn die Lust gar nicht oder noch nicht da ist. Die O'Leary-Studie jedenfalls zeigt, dass Langzeitliebende öfter Sex haben und regelmässiger Sex haben als andere Pärchen. Erforscht ist übrigens auch, dass wer mehr Sex hat auch mehr Sex will. Für einmal ist das mit dem Huhn und dem Ei völlig egal.
9. Glücklich sein. Glückliche Menschen sind die besseren Liebhaber. Mehr gibts dazu nicht zu sagen.
10. Kontrolle: Ja, Sie haben richtig gelesen – wer wissen will, mit wem sich der Partner trifft, hat grössere Chancen, den Partner auch zu behalten. Liebende haben nun mal Ähnlichkeiten mit Stalkern. Vor allem wenn sie männlichen Geschlechts sind.
11. Obsession. Frauen hingegen, wenn sie in langen Beziehungen glücklich werden wollen, sollten sich ein kleines bisschen Obsessivität nicht verdenken. Offenbar sind erfolgreiche Langzeitliebhaberinnen in Gedanken nie weit von ihrem Partner entfernt. (Lesen Sie auch: «Das Buch, das Frauen fesselt»)
12. Leidenschaft. Nein – da ist nicht in erster Linie die horizontale Leidenschaft gemeint, sondern die alltägliche. Menschen, die ihre Emotionen nicht homöopathisch dosieren in ihrem Leben, geben die besseren Langzeitliebhaber ab. Wer sich also so richtig aufregen kann oder gerne lacht, wer sich reinknien will und wer immer ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Kick ist, hat gute Voraussetzungen mit seinem Partner alt zu werden.